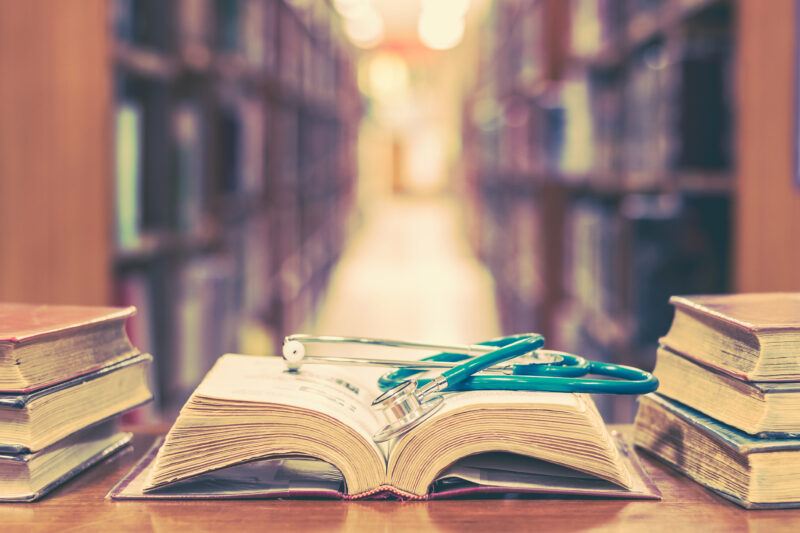Medizinstudium Ablauf: Die wichtigsten Phasen im Studium im Überblick
Das Medizinstudium in Deutschland gliedert sich in Vorklinik, Klinik und das Praktische Jahr und führt nach dem dritten Staatsexamen zur Approbation. In diesem Artikel erfährst du alles über den Ablauf, die Prüfungen und den Übergang ins Berufsleben als Arzt oder Ärztin.