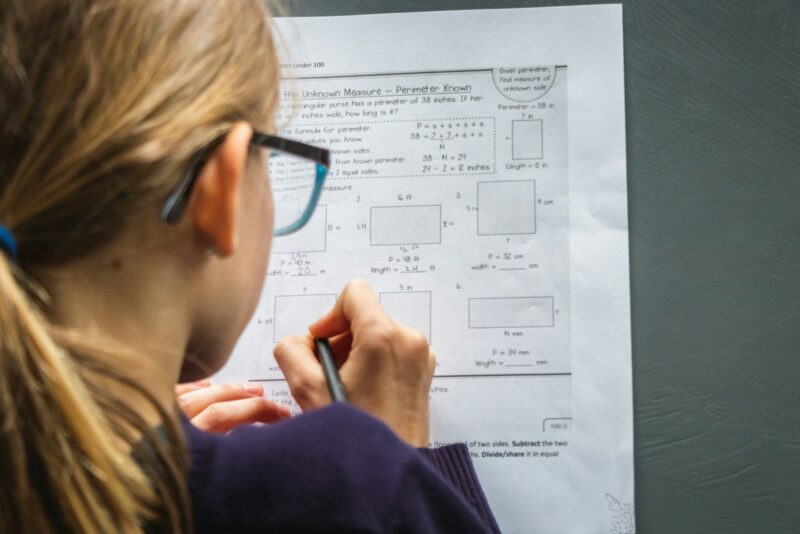Karriere nach dem Medizinstudium: Klinik, Forschung oder Selbstständigkeit?
Nach dem Medizinstudium stehen drei Hauptwege offen: die Arbeit in der Klinik mit strukturierter Facharztausbildung und klaren Aufstiegsmöglichkeiten, eine Laufbahn in der Forschung mit Fokus auf wissenschaftliche Projekte und internationale Zusammenarbeit, oder die Selbstständigkeit mit eigener Praxis und unternehmerischer Verantwortung. Die Wahl hängt von persönlichen Interessen, Zielen und dem Wunsch nach Patientenkontakt, wissenschaftlicher Tätigkeit oder beruflicher Unabhängigkeit ab.