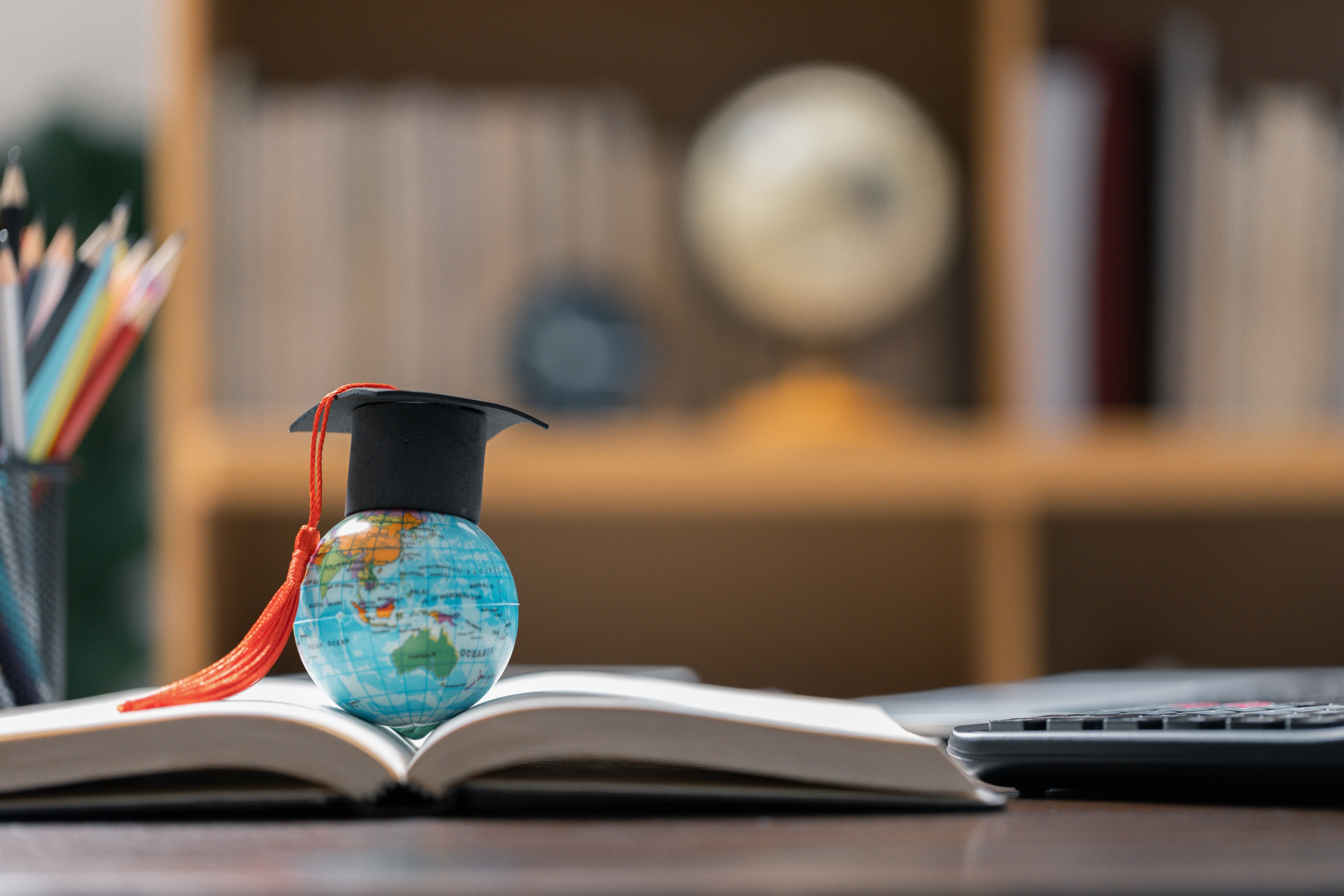Koordinierungsregeln im Medizinstudium
Die Koordinierungsregeln sind ein zentrales Steuerungssystem im Bewerbungsverfahren für das Medizinstudium in Deutschland, das festlegt, wie Zulassungsangebote im Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) verarbeitet werden, indem Bewerbungen priorisiert und Mehrfachzulassungen verhindert werden.