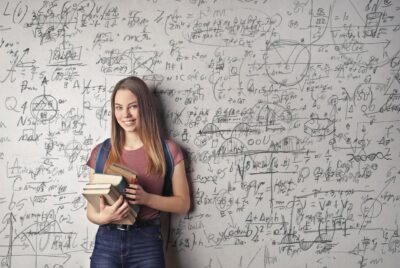Abiturbestenquote (ABQ)
Die Abiturbestenquote (ABQ) ist eine der drei Hauptquoten im Vergabeverfahren für zulassungsbeschränkte Studiengänge in Deutschland und regelt, dass 30 % der verfügbaren Studienplätze in Fächern wie Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie ausschließlich nach der Abiturdurchschnittsnote vergeben werden.